
Gefahrstoffe
Rückblick auf die erste Fachveranstaltung Strahlarbeiten in Dresden
Ende 2022 hatte eine Gruppe von Fachleuten aus verschiedener Fachbereichen der DGUV im Rahmen einer Projektgruppe begonnen, das Schriftenwerk zu Strahlarbeiten kritisch auf einen Überarbeitungsbedarf zu prüfen. Im Rahmen der 1. Fachveranstaltung Strahlarbeiten sollten nun die ersten Handlungshilfen und Erfahrungen dargestellt werden. Über 100 Arbeitsschutzakteure aus Unternehmen, von Herstellern und Unfallversicherungsträgern trafen sich zum Erfahrungsaustausch auf Einladung der BGHM am 13. und 14. August 2025 im DGUV-Kongresszentrum Dresden.

Mehr als 100 Interessierte nahmen an der 1. Fachveranstaltung Strahlarbeiten teil.
Das Regelwerk der Unfallversicherungsträger (UVT) bestand seit 2007 im Wesentlichen nur aus zwei Kapiteln der DGUV Regel 100- 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“. Wie Siegfried Turowski (BGHM) einführend erklärte, bilden diese zwei Kapitel zum Trockenstrahlen (Verwendung von körnigen Strahlmitteln, Kap. 2.24) und zum Flüssigkeitsstrahlen (Kap. 2.36) auch eine erste Unterteilung der Strahlverfahren. Hinzu kommen spezielle Strahlverfahren, wie z. B. Reinigungsverfahren mit Laserstrahlung. Das Kapitel 2.24 der DGUV Regel 100-500 wurde Ende 2024 bereits zurückgezogen, erhaltenswerte Inhalte wurden u. a. in die DGUV Regel 109-607 „Branche Metallbau“ übernommen. Hier fehlen noch Erfahrungen, ob diese kurzen Hinweise für die Praxis ausreichen.
Der Newsletter der BG BAU
Hier erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail – so etwa auch Hinweise zu neuen Arbeitsschutzprämien und Seminarangeboten.
Sie möchten keine Ausgabe der BauPortal verpassen? Klicken Sie einfach das entsprechende Kästchen in den Profileinstellungen an. Den Link zum Profil finden Sie am Ende jedes Newsletters oder direkt nach der Anmeldung.
Über Regelwerk und Normung
Unter der Überschrift „Regelwerk und Normung“ erläuterte Dr. Martin Riester vom VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) die Grundsätze der Regelungen in der EU. Anforderungen an die Beschaffenheit von Geräten und Maschinen werden nur grundlegend in europäischen Verordnungen beschrieben. Die Konkretisierung erfolgt dann in Normen. Der Bereich der Arbeitssicherheit wird auf der Grundlage von Mindestanforderungen aus den europäischen Richtlinien national durch staatliche Vorschriften oder in Deutschland auch durch Regelungen der UVT umgesetzt. Er berichtete dann über einige neue Entwicklungen in der Normung von Strahlanlagen. So wurde Norm DIN EN 1248, die Sicherheitsanforderungen für Strahlanlagen festlegte, 2025 durch die Norm DIN EN ISO 23779 ersetzt, die nun auch Umweltanforderungen beschreibt.
Flüssigkeitsstrahlen
Die Anwendungsgebiete, besondere Gefahren und erforderliche Schutzmaßnahmen beim Flüssigkeitsstrahlen wurden von drei Experten der BG BAU vorgestellt.
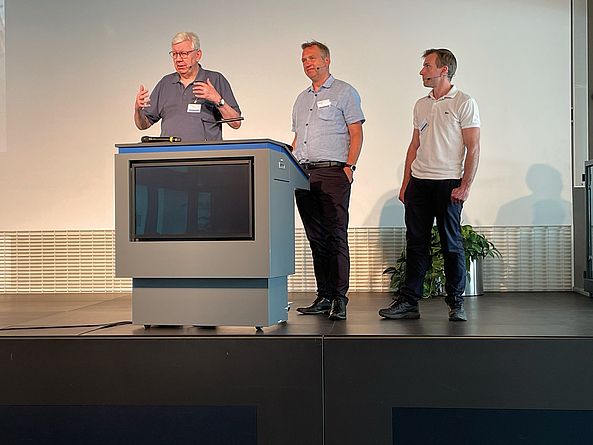
Rainer Dörr, Christof Kirchhoff und Michael Alexander Fritz ( v. l. n. r.) im Austausch mit dem Publikum
Berücksichtigung des Arbeitsdrucks
Einführend beschrieb Rainer Dörr die Bedeutung des Arbeitsdrucks. In der Regel wird beim Flüssigkeitsstrahlen mit Wasser gestrahlt. Ab einem Druck von 250 bar besteht eine erhöhte Gefahr von Verletzungen beim Einsatz von handgeführten Flüssigkeitsstrahlern. Die europäische PSA-Verordnung sieht deshalb vor, dass beim Hochdruckstrahlen besondere PSA (Persönliche Schutzausrüstungen) getragen werden, die bei einem Arbeitsdruck von 200 bar oder mehr schützen. Dazu wird in den Guidelines ausgeführt, dass die ungeschützte Haut bereits ab 80 bar penetriert werden kann, normale Arbeitskleidung jedoch einen Schutz bis zu 200 bar beim Hochdruckstrahlen bietet. Hochdruckreiniger für den privaten Gebrauch haben deshalb in der Regel einen Arbeitsdruck von weniger als 200 bar.
Einsatz bei der Betonsanierung
Bei höheren Druckwerten sprechen Hersteller gerne von Höchstdruck- oder Ultra-Hochdruck-Strahlverfahren. Christof Kirchhoff beschrieb am Beispiel der Betonsanierung die Technik des Arbeitsverfahrens. Bei einer Auswertung der DGUV-Zahlen der meldepflichtigen Unfälle über einen Zeitraum von zehn Jahren wurden bei Einsatz von Hochdruckreinigern pro Jahr ca. 280 Unfälle in Deutschland registriert, pro Arbeitstag also ein schwerer Unfall. In etwa der Hälfte der Fälle kam es zu Wunden und Zerreißung. Durch die Schneidwirkung des Flüssigkeitsstrahls sind auch sehr schwere Schnittverletzungen möglich. Die eingesetzten Geräte liefern einen Arbeitsdruck bis zu 3.000 bar. Soweit es betriebstechnisch möglich ist, sind mechanisch geführte Spritzeinrichtungen zu verwenden. Da in der Praxis aber häufig handgeführte Flüssigstrahler genutzt werden, ist eine Überprüfung der die auftretenden Rückstoßkräfte nötig. Hersteller bieten dafür auch Apps zur Berechnung.
Einsatz in der Gebäudereinigung
Michael Alexander Fritz berichtete, dass im Bereich der Gebäudereinigung häufig Hochdruckreiniger mit einem Arbeitsdruck von unter 200 bar eingesetzt werden. Bei der Auswahl der Schutzmaßnahmen müssen deshalb auch andere Gefährdungen beachtet werden. Für die Fassaden- und Dachreinigung werden deshalb Stangensysteme empfohlen und von der BG BAU auch gefördert, die ein Arbeiten vom Boden aus ermöglichen. Dadurch können Gefährdungen durch Abstürzen vermieden werden. Da auch das Kapitel 2.36 Flüssigstrahlen der DGUV Regel 100-500 wohl zurückgezogen werden soll, wird es notwendig werden, weitere Handlungshilfen zu entwickeln.

Infostand mit PSA und anderen Produkten auf der Fachveranstaltung Strahlarbeiten
Während der Pausen und der begleitenden Abendveranstaltung war im Kongresszentrum ein Marktplatz mit Infoständen aufgebaut. Die Besucher konnten sich dort über die Auswahl und mögliche Kombinationen von PSA (Persönliche Schutzausrüstung) und weiteren Lösungen informieren. Neben Informationen der beteiligten Fachverbände wurden insbesondere auch Beratungsangebote der Unfallversicherungsträger aufgezeigt.
Brand- und Explosionsschutz
Beim Trockenstrahlen von Guss-, Stahl und Leichtmetall-Werkstoffen fallen häufig brennbare und explosionsfähige Stäube an. Beim Absaugen kann es dabei durch aufgewirbelte Stäube zu Staubexplosionen kommen. Rolf Woyzella (BGHM) berichtete über einige Explosionsereignisse und die Konsequenzen für die Gestaltung der Schutzmaßnahmen. Bei der Konstruktion von Absauganlagen sind Kenntnisse über die Größenverteilung und Eigenschaften der anfallenden Staubpartikel wichtig. Dazu stellte Dr. Alexey Leksin vom IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) die Datenbank GESTIS-STAUB-EX vor. Diese Datenbank enthält wichtige Brenn- und Explosionskenngrößen von über 7.000 Staubproben aus fast allen Branchen und hilft bei der sicheren Handhabung brennbarer Stäube und der Konzeption von Schutzmaßnahmen.

Im Außenbereich wurden durch Stäube hervorgerufene Staubexplosionen demonstriert.
Reinigen mit Laserstrahlung
Der zweite Tag der Veranstaltung war weiteren Spezialverfahren gewidmet. Durch den Fachbereich Holz und Metall wurde 2024 in der DGUV-Schriftenreihe die Information „Fachbereich AKTUELL Strahlarbeiten – Reinigen und Entschichten mit Laserstrahlung (FBHM-139)" veröffentlicht.
Dr. Michael Grimann (Glatt Laser Process Technology GmbH) berichtete aus der Praxis über den Einsatz von Laserstrahlung. Mittels Laserstrahlung können Oberflächen verschiedener Materialien schonend gereinigt oder entschichtet werden. Bei diesen Verfahren können durch den leistungsstarken Laserstrahl Korrosionsschichten, Lacke und Beschichtungsstoffe oder Verschmutzungen und Prozessrückstände entfernt werden. Da keine Strahlmittel eingesetzt werden und die aus den entfernten Beschichtungen freigesetzte Gefahrstoffe sofort abgesaugt werden, ist das Laserverfahren sehr emissionsarm.
In der neuen Schrift FBHM-139 werden Tätigkeiten mit handgeführten Lasereinrichtungen behandelt, sie zeigt auch die Anforderungen für die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und der dabei erforderlichen Fachkunde auf. Anhand dieser Handlungshilfe ging Martin Brose (BG ETEM) auf die Gefährdungen und Schutzmaßnahmen ein. Zur Bearbeitung werden leistungsstarke Laser der Klasse 4 eingesetzt, die Laserstrahlung kann Schäden an den Augen und an der Haut verursachen. Durch den Abtrag der Beschichtungen können Gefahrstoffe freigesetzt werden, die über die Atemwege aufgenommen in die Lunge gelangen können, da in der Regel alveolengängige Partikel vorhanden sind.
Trockeneisstrahlen
Kohlendioxid (CO2) wird in fester Form bei –78 °C beim Trockeneisstrahlen eingesetzt, um Ablagerungen und Beschichtungen auf Oberflächen schonend zu entfernen. Maximilian Stern (BG Verkehr) erläuterte die Grundlage dieses Strahlverfahren und berichtete über Anwendungen in der Praxis. Die Gefährdungen beim Umgang mit Trockeneis werden in der DGUV Information 213-115 „Tätigkeiten mit Trockeneis, Herstellung, Lagerung und Verwendung“ behandelt. Die Besonderheiten beim Einsatz bei Strahlenarbeiten wurde von der Projektgruppe Strahlenarbeiten in einer neuen Informationsschrift umfangreich erläutert. Diese neue Schrift soll in Kürze unter der Bezeichnung DGUV Information 209-101 „Strahlarbeiten – Trockeneisstrahlen“ erscheinen. Bei diesem Strahlverfahren entstehen sehr hohe Lärmemissionen von bis zu 127 dB (A), vergleichbar dem Lärm eines startenden Düsenjägers. Umfangreicher Gehörschutz ist daher erforderlich.
Beim Strahlen mit Trockeneis entsteht aus 1 kg festem Kohlendioxid ca. 500 l Gas. Dieses Gas verdrängt nicht nur den Sauerstoff aus der Umgebung, sondern führt ab einem Gehalt von 2 % in der Einatemluft zu Symptomen bis zu Bewusstseinsstörungen. Oberhalb von ca. 10 % CO2 in der Atemluft kann es zum Tod durch Ersticken führen. Herbert Fischer (BG RCI) leitete mit dieser Schilderung der Risiken beim Umgang mit Trockeneis in das Thema Atemschutz bei Strahlarbeiten über. Die Anforderungen dieser Persönlichen Schutzausrüstungen werden in verschiedenen Normen beschrieben. Zentral für Strahlarbeiten ist insbesondere die Norm DIN EN ISO 14877:2003 „Schutzkleidung für Strahlarbeiten mit körnigen Strahlmitteln". In der Ausführung Typ 3 muss diese Schutzkleidung als Teil einer Kombination mit einem geeigneten Atemschutzgerät geprüft sein.
Fazit und Ausblick
Aufgrund der sehr positiven Resonanz aus dem Teilnehmerkreis wurde mit der Planung einer weiteren Fachveranstaltung im Jahr 2027 begonnen.
Autor
Ausgabe
BauPortal 4|2025
Das könnte Sie auch interessieren

Lärm, Arbeitsschutz, Gesundheit
Entwicklungen und Trends zum Thema Lärm am Bau
Lärm auf Baustellen schadet nicht nur dem Gehör. Der Beitrag beleuchtet gesundheitliche Folgen und zeigt innovative Lösungen für mehr Lärmschutz im Bauwesen.

Gesundheitsschutz, Gefahrstoffe
Aktuelles zum Umgang mit PAK in der Bauwirtschaft
Ein von der EU-Kommission empfohlener Grenzwert für PAK ist derzeit in der Abstimmung. Was bedeutet das für Arbeiten mit PAK-haltigen Materialien in der Bauwirtschaft?

Gefahrstoffe
Transport von Asbest – Neuregelung bei der Gefahrgutbeförderung
Sondervorschriften erlauben jetzt den Transport des Gefahrgutes Asbest, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.